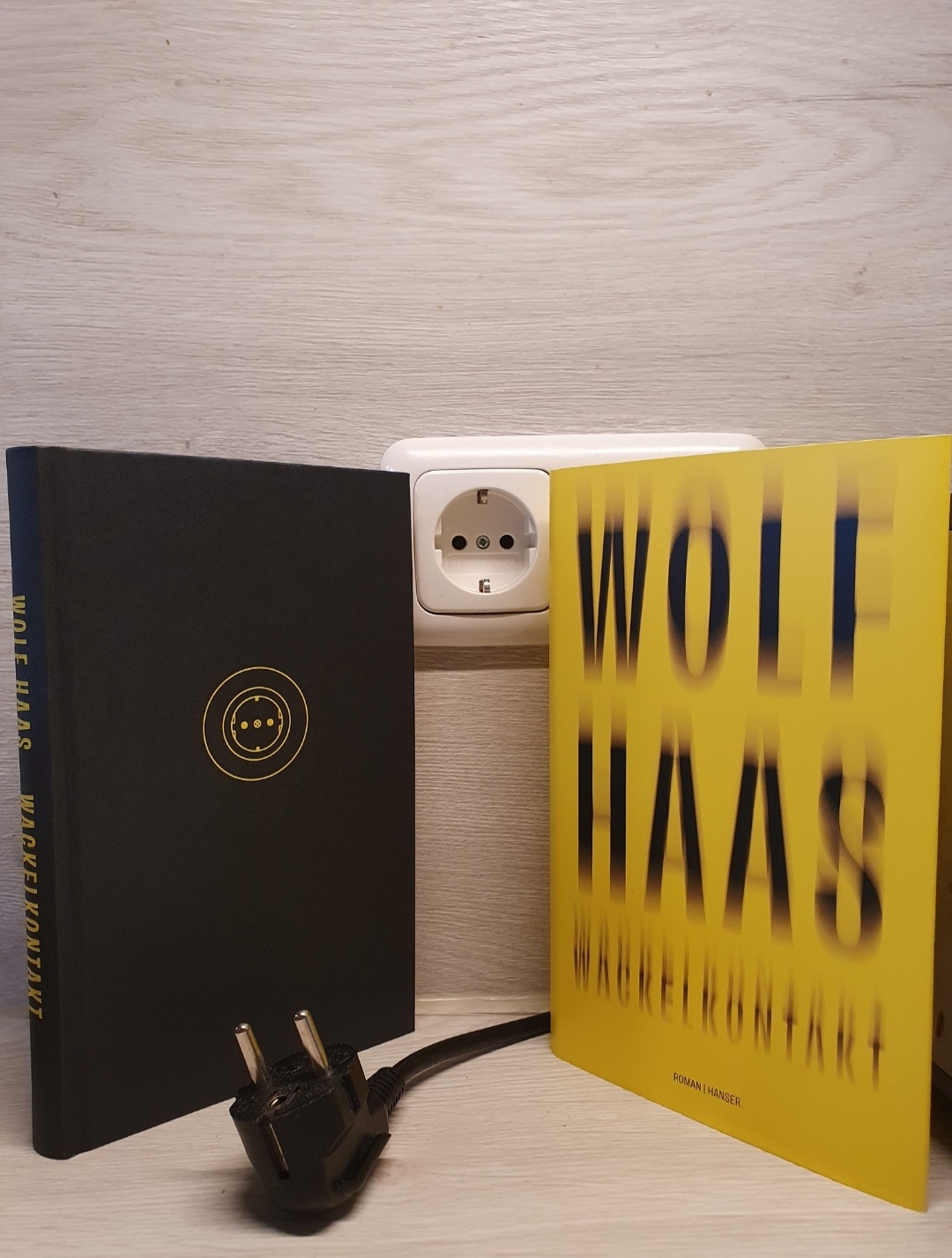“Vielleicht ist es an der Zeit, einen längst fälligen Frühjahrsputz in mir zu machen: verstaubte Glaubenssätze ab-swiffern, veraltete Rollenverhältnisse entsorgen, Werte neu anordnen. Ich will, dass es in mir glänzt.” (S. 109)
Viele junge und mittelalte Menschen kehren der Kirche heutzutage zurecht den Rücken. Was in diesem konservativen Männerverein abgeht, ist leider ganz und gar nicht mehr feierlich. Da können sie noch so viel Wein trinken und Hostien essen. Die Diskriminierung von Frauen und queeren Menschen zieht sich bis in unsere heutige, man sollte meinen, moderne und aufgeklärte Zeit. Am allerschlimmsten sind aber die furchtbaren Missbrauchsskandale, die vertuscht und verschleiert werden.
Die Protagonistin des Romans “Bible Bad Ass”, Klara, hat ebenfalls mit der konventionellen Kirche gebrochen. Sie ist Journalistin bei einem hippen Frauenmagazin und als sie für ihren Chef - ausgerechnet während ihrer MENstruation - mal wieder eine tolle Story aus dem Hut zaubern soll, stößt sie auf die Geschichte der queeren evangelischen Pfarrerin Annina Ligniez, die ihr eine andere, sehr weibliche Sicht auf Bibel und die Kirche offenbart. Annina Ligniez ist eine reale Person, mit der Edith Löhle für den Roman tatsächlich zusammengearbeitet hat. Als Klara plötzlich in eine Whatsapp-Gruppe gerät, in der biblische Frauen ihre realen Geschichten erzählen, kommt es bei der Journalistin zu einem Umdenken: Können wir nicht zu einer modernen Form des Glaubens finden, indem wir den Fokus auf Schwesternschaft und Liebe lenken, statt auf Männerwirtschaft und Ausgrenzung?
Das positive und das negative Element dieses Romans sind für mich eins: eine Flut an Informationen. Wenn man böse ist, könnte man sagen: Infodump, wenn man nett ist: Aufklärung. Man merkt einfach, dass die Autorin Journalistin und mit dem Finger stets bei Google ist. Für einen Roman mit Ich-Erzählerin fehlt mir die detaillierte Herausarbeitung des inneren Konflikts der Hauptfigur. Klar geht es auch immer wieder darum, dass sie angepisst ist von ihrem frauenfeindlichen, nicht-gendernden Umfeld und um die Probleme mit ihrem Freund Nico. Letzteren liebt sie eigentlich, aber er nimmt sie in ihrer extrem feministischen Haltung nicht immer ernst und das führt zu Problemen. Aber ich habe die Figur Klara dennoch nicht ganz greifen können, sie kam oft rüber wie ein wandelndes Klischee. Eigentlich Katholikin mit schwäbischen Wurzeln, die im hippen Berlin wohnt. Prenzlauer-Berg-Drama ick hör dir trapsen…
[Spoiler ahead] Als Realistin finde ich es nicht gut, dass uns das Buch mit einer metaphysischen Erklärung für den Chat mit den biblischen Frauen abspeist. Woher kam dann das Ganze jetzt? Ist es fake oder real hardcore metaphysisch? Und dass die Protagonistin am Ende als esoterische und singuläre Spinnerin dasteht, hat mir auch nicht gefallen. Eine potenzielle Pseudo-Reformatorin, die alle Beziehungen zu ihrem bisherigen Leben abbricht? Interessant wäre gewesen zu wissen, was sie jetzt daraus macht. Aber an dieser Stelle endet leider das Buch.
Das heißt jetzt allerdings nicht, dass ich aus “Bible Bad Ass” nichts mitgenommen habe. Während das Buch als Roman für mich kaum funktioniert, ist es als Informationsquelle für die jahrhundertelange Frauenfeindlichkeit der Institution Kirche Gold wert. Ich habe sehr viel gelernt über weibliche Geschichte und die Ungerechtigkeiten, die Männer den biblischen Frauen - angetan haben, indem sie deren Geschichte und Bedeutung z.B. für Jesus fehlinterpretiert oder klein gehalten haben. Ob es sie nun gab oder nicht, ist dabei irrelevant.
Eigentlich ein sehr tolles, informatives und wichtiges Buch. Als erzählendes Sachbuch hätte es mir aber noch besser gefallen.